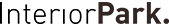Kolumne Nachhaltigkeit
md Magazin
Interior | Design | Architekture
Ausgabe November/Dezember 2024
Kolumne InteriorPark. auf Seite 46-47
Wo bitte geht’s denn hier zum Wandel?
Wer sich berufsbedingt regelmäßig fortbildet und sich aufmerksam durch den Berufsalltag bewegt, sieht sich mit inflationären Aufrufen konfrontiert. Zukunft Bauen, Bauwende, Transformation, Paradigmenwechsel: die Liste der Buzz-Words ist lang und die Vielzahl an Angeboten zur Wissensvermittlung auf Veranstaltungen und durch Publikationen beeindruckend.
Aber wie steht es wirklich um die Veränderungen in der Baubranche?
Da lohnt sich ein Blick auf unsere Sprache und auf die Floskeln, die wir täglich ganz selbstverständlich einsetzen, und die viel über uns verraten. Demnach schützen wir mit unserem Tun bereits das Klima, die Umwelt, die Natur. Und vor was genau „schützen“ wir die Umwelt? Sind wir wirklich „freundlich“ zu unserer Umwelt?
Nach unserem Verständnis ist Umwelt alles, was uns umgibt und Natur alles, was nicht von Menschen geschaffen wurde. Diese sprachlichen Unterscheidungen zwischen wir und die, also die Umwelt und die Natur, ist eine Erfindung der westlichen Welt. Durch diese Kategorisierungen schaffen wir Distanz und legitimieren unser Tun.
Würden wir der „Natur zuliebe“ handeln, dürften wir eigentlich gar nicht handeln. Die Natur kommt gut ohne uns aus – wir aber nicht ohne sie. Unsere Eingriffe in die komplexen Systeme der Natur mit all ihren Abhängigkeiten und Wechselwirkungen haben existenzielle Auswirkungen. Sie zeigen sich mittlerweile offensichtlich und weltweit durch Extremwettereignisse und durch den rapiden Verlust der Artenvielfalt – wobei letzterer schleichend im Stillen erfolgt, dabei aber in keinster Weise weniger gravierend ist.
„Die Natur schlägt zurück“ – ernsthaft?
Eigentlich geht es nicht um das Klima, die Umwelt oder die Natur. Es geht um uns. Wie wir in Zukunft leben und den dafür notwendigen Wandel aktiv gestalten wollen. Damit auf Worte Taten folgen können, bedarf es auch einer passenden Sprache.
Notwendige Rahmenbedingungen existieren. Wir haben uns bereits völkerrechtlich darauf geeinigt die Dekarbonisierung auf allen Ebenen voranzutreiben. Feste Ziele sind bindend vereinbart. Der Bausektor spielt dabei eine zentrale Rolle. Für nachhaltiges und kreislauffähiges Bauen innerhalb der planetaren Grenzen müssen neue Qualitäten in Entwurf und Ausführung entwickelt werden, um die gesetzten Ziele erreichen zu können. Diese Aufgaben lassen sich als Chance begreifen.
Die Wiederverwertung und Wiedereinbringung von Materialien sind seit jeher gelernte Praxis. Durch die große Vielfalt und Verfügbarkeit an Bauprodukten sind in den Industrienationen die Mechanismen in Vergessenheit geraten. Die Kombination vernakulärer und neuer Bautechniken spielen aber bei zukunftsfähigen Planungen eine zentrale Rolle. Es lohnt sich hierzu Kompetenzen aufzubauen.
Umbauen und Weiterbauen stellen den größten Bereich an Bauaufgaben dar. Hier rückt insbesondere die Innenarchitektur in den Fokus. Sich verändernde Nutzungsanforderungen bedürfen flexibler Raumplanungen. Das gilt, aufgrund demografischer Veränderungen, sowohl für den privaten Bereich mit der Neuaufteilung leerstehender Einfamilienhäuser als auch dem Leerstand im urbanen Kontext, wie beispielsweise ehemalige Kaufhäuser, die veränderten sozio-kulturellen Anforderungen gerecht werden müssen. Es gilt Lebensräume zu schaffen, die neben ästhetischen und funktionalen Aspekten auch sozialen, ökologischen sowie ökonomischen Ansprüchen gerecht werden. Innenarchitektur und Architektur können daher nicht mehr losgelöst von allen dynamischen Entwicklungen behandelt werden, sondern müssen sich als Teil der Transformationsprozesse begreifen. Das bedeutet wieder dem Urspruch unseres Berufsstandes gerecht zu werden und gesellschaftliche Veränderungen zu gestalten.
Mit einer positiven inneren Haltung und Zuversicht können wir alle aktiv zum Erfolg der Bauwende beitragen. Das wäre der Weg zum Wandel.