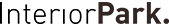„Wir können morgen starten“
Interview mit Tina Kammer von InteriorPark. über Projektplanung, nachhaltige Architektur und den Umbau des Bauwesens. Sie meint: „Wenn wir bedarfsgerecht und effizient planen wollen, brauchen wir dringend eine neue Idee davon, wie wir in Zukunft leben wollen.“
Das Interview führte Frank Augustin, Chefredakteur, agora42 Das philosophische Wirtschaftsmagazin
04/2025, Seite 38 – 55
Das Magazin kann direkt beim Verlag online bestellt werden.
Frau Kammer, die Bauwirtschaft ist ein ressourcenintensiver Sektor, verantwortlich für rund 40 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes und 60 Prozent des globalen Mülls. Muss angesichts dieser desaströsen Umweltbilanz schleunigst eine „Bauwende“ her, analog zur Klimawende?
Sagen wir es so: Ohne Bauwende gibt es auch keine Klimawende. Natürlich müssen wir die Dekarbonisierung auf allen Ebenen vorantreiben, nicht nur in der Bauwirtschaft. Aber in der Bauwirtschaft ist dies von entscheidender Bedeutung, weil die Materialströme wahnsinnig groß sind. Zudem überschneidet sich die Bauwirtschaft mit anderen wirtschaftlichen Sektoren, wie Industrie, Energie und Mobilität. Das lässt sich teilweise gar nicht trennen. Denken Sie beispielsweise an den Transport der ganzen Baustoffe und der Maschinen. Die Bauwirtschaft ist die ressourcenintensivste Industrie mit etwa 60 % Ressourcenverbrauch. Allein bei den mineralischen
Rohstoffen liegt sie bei einem Anteil von etwa 80 %. Und das geht natürlich immer auch mit CO2-Emissionen einher, denn die Materialien werden gefördert, transportiert und verarbeitet. Wenn wir die Dekarbonisierung in der Bauwirtschaft nicht schaffen, dann schaffen wir sie in allen anderen Bereichen auch nicht.
Wenn wir das große Ganze in den Blick nehmen, wenn wir vom Ziel, vom Ende her planen – was wäre ein Bauen, von dem Sie sagen würden: Da müssen wir hin?
Das ist schon lange bekannt und auch nicht von mir: Wir müssen erstens mit Sekundärrohstoffen arbeiten, das heißt mit Materialien, die durch Recycling aus Abfällen oder bereits verbauter Produkte gewonnen werden und zweitens mit nachwachsenden Rohstoffen. Damit man sich eine Vorstellung von den Mengen machen kann: So, wie wir hier sitzen, verbraucht jeder einzelne von uns in Deutschland, also der Fotograf und wir beide, jeweils ein Kilo Steine pro Stunde. Ein weiteres Beispiel: Sand, der unter anderem für die Betonindustrie benötigt wird, ist weltweit der zweitbegehrteste Rohstoff nach Wasser!
Also: Sekundärrohstoffe und nachwachsende Rohstoffe. Und dann geht es, global betrachtet, natürlich auch um gerechte Verteilung, denn im Gegensatz zum Norden wächst die Bevölkerung im globalen Süden. Wie werden die Ressourcen aufgeteilt? In Deutschland haben wir eher mit wachsendem Flächenbedarf, Leerstand und einem Umverteilungsthema zu tun, als dass neue Gebäude benötigt werden. Im Moment leben weltweit etwa 50 % der Menschen in Städten. Bis 2050 werden es 70 % sein und da sprechen wir auch über Städte, die noch gar nicht gebaut sind. Und die Frage ist: Aus was werden die Häuser für diese Menschen denn gebaut? Insofern ist die Ressourcenfrage auch immer eine Gerechtigkeitsfrage. Bei der Bauwende geht es also um viel mehr als um die Frage, wie wir hier in Deutschland unsere Gebäude ertüchtigen. Und dabei darf man nicht vergessen, dass unsere Bauindustrie weltweit aktiv ist und deutsche Architekturbüros international arbeiten.
Wenn man von nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoffen spricht, kann man sich schwer vorstellen, wie das in der Breite funktionieren soll. Sie fordern die schnellstmögliche Transformation des Bauens hin zu einem kreislaufgerechten Bauen. Was ist darunter zu verstehen?
Da kann ich mit der Natur beginnen: Die Natur kennt keinen Abfall. In der Natur befinden sich Energie- und Materialströme in einem Kreislauf. Wir sind in einem geschlossenen System gefangen: Alles, was wir tun, bleibt auf der Erde. Die Materialien werden nur umgewandelt: durch Verdunstung, Verrottung oder Verbrennung landen sie in der Atmosphäre. In der Natur sind diese Prozesse immer im Gleichgewicht. Wir müssen also lernen, in Kreisläufen zu denken und zu planen. Das ist ein großer Schritt, weil wir das bisher nicht getan haben. Wir schmeißen Dinge einfach weg und glauben auch, dass wir sie wegschmeißen – dabei können wir das gar nicht. Sie bleiben ja nach wie vor auf der Erde. Wir müssen also lernen, keinen Abfall mehr zu produzieren.
Wenn wir nachwachsende Rohstoffe verwenden, haben diese den Vorteil, dass sie durch die Photosynthese schon CO2 gebunden haben. Weil das CO2 im Material gespeichert ist, können Gebäude auch als CO2-Speicher generiert und genutzt werden. Wir haben da in der Bauwirtschaft also noch riesige Möglichkeiten.
Auf die Bauplanung bezogen ändert sich eine Sache grundlegend: Beim kreislauffähigen Bauen ist keine lineare Planung möglich. Alle am Bau Beteiligten müssen an einem Strang ziehen und das bedeutet eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sich von der gewohnten, gängigen Praxis zu verabschieden, wird notwendig sein, um neue Methoden und Prozesse zu entwickeln. Dazu erstellen aktuell unterschiedliche Institutionen entsprechende Rahmenbedingung. Selbst die DIN als Flaggschiff hat bereits Handlungsempfehlungen erarbeitet, bei denen ich selbst aktiv war.
Eine wichtige Voraussetzung für kreislauffähiges Bauen wäre auch, dass die Gebäude so gebaut werden, dass ihre Bestandteile wieder in den Kreislauf zurückkehren können, richtig? Zum Beispiel ist es bei Dämmmaterialien ja oft ein Problem, dass man diese nicht wiederverwerten kann.
Genau, es ist notwendig mit Monomaterialien arbeiten, also nicht mit verklebten, verbackenen Materialien. Bei Kreislaufwirtschaft ist Teil der Logik auch Materialgesundheit. Wir dürfen keine Gifte verarbeiten, weil wir die anschließend wieder recyceln. Das heißt, wir müssen schon während der Planungsphase das Ende mitplanen, indem wir reversible also rückbaubare Konstruktionen einsetzen.
Wir haben in Deutschland einen riesigen Gebäudebestand, der nach heutigen Anforderungen transformiert werden muss bzw. bei dem die aktuelle Nutzung gar nicht mehr gebraucht wird. Man denke an die großen Kaufhäuser, in denen enorm viel Material verbaut ist. Am Ende ist ein Gebäude auch ein Materiallager. Wie gehen wir mit diesem Material um? Können wir die Gebäude überhaupt zurückbauen? Damals hatte man in der Planungsphase das Ende nicht mitbedacht. Wir haben also keine Nachweise, was da wie verbaut worden ist. Es bedeutet viel Aufwand das herauszufinden, damit wir diese Materialien, diese Bauprodukte zurückbekommen und wiederverwenden können. Und die Frage ist dann auch: Können wir diese Baustoffe eins zu eins wieder einsetzen oder müssen sie aufgearbeitet werden? Muss ein Baustoff erst mal zerschreddert und zu neuem Material umgewandelt werden – was auch wiederum Emissionen bedeutet?
Und da stehen wir heute, wenn wir über kreislauffähiges Bauen sprechen: Auf der einen Seite sprechen wir über den Gebäudebestand. Auf der anderen Seite geht es um die Neubauten: Wie können wir heute die Konstruktionen dahingehend ertüchtigen, dass wir rückbaubar planen? Und dafür brauchen wir eine Form von Nachweis, damit künftige Generationen nachvollziehen können, wie ein Gebäude gebaut worden ist. Da sprechen wir vom Gebäude-Ressourcenpass, den einige Plattformen schon anbieten.
Das hieße: Wenn wir den Ressourcenpass flächendeckend einführen, dann können sich alle darüber informieren, was in dem Gebäude, in dem sie wohnen oder das sie kaufen wollen, an Materialien verbaut worden ist?
Richtig. Und die Herausforderung ist dann langfristig – die digitalen Möglichkeiten ändern sich ja immer wieder –, dass man das kontinuierlich auf den neuesten Stand bringt. Wenn wir das weiterdenken, dann haben wir nicht nur ein Gebäude, sondern auch ein Materiallager. Im Moment planen wir Gebäude und errechnen während der Planungsphase, was die Erstellung des Gebäudes kostet. Entsprechend sind auch die Abschreibungsmodalitäten. Wenn wir nun aber den Restwert des Gebäudes bewerten – das können wir, weil wir wissen, was verbaut wurde –, dann haben wir ein ganz anderes Modell, weil der Material-Restwert ja immer gegeben ist. Ob in zehn, 20 oder 50 Jahren – das Gebäude hat einen Restwert.
Und die Materialien müssten nicht unbedingt nur für Gebäude wiederverwendet werden, sondern vielleicht auch für Brücken oder Spielplätze oder was auch immer …
Die spätere Nutzung ist offen. Die Lebensbedingungen der Menschen und ihre Arbeitswelten verändern sich. Das heißt, wir brauchen flexiblere Grundrisse, damit ein Gebäude auf neue Nutzungsformen reagieren und langfristiger genutzt werden kann. Noch einmal das Beispiel der Kaufhäuser: Das sind große Bauvolumen, die sehr tief sind. Es gibt keinen Tageslichteintritt im inneren Bereich. Und was machen wir jetzt daraus? Hier wurde eben nicht mitbedacht, dass es irgendwann keine Kaufhäuser mehr geben, dass dieses Geschäftsmodell einmal obsolet sein könnte. Deshalb ist es so wichtig, dass die Planung flexible Nutzungen ermöglicht und Gebäude so konzipiert sind, dass sie ohne großen Aufwand angepasst werden können.
Dazu habe ich auch noch ein schönes aktuelles Beispiel: Die Stadt Wendlingen hat ein Parkhaus in Holzbauweise gebaut, das so konzipiert ist, dass es sehr einfach zu Wohnraum umgenutzt werden kann, falls es nicht benötigt wird.
Wenn wir über sinnvolle Planung sprechen, müssen wir auch darüber sprechen, was einer solchen Planung entgegensteht. Einen Punkt haben Sie schon angesprochen: die Gewohnheit, immer nur linear zu planen. Was sind denn weitere Gründe dafür, dass nachhaltiges Bauen so zögerlich umgesetzt wird?
Da gibt es leider viele. Zunächst ist die Bauwirtschaft an sich eine sehr konservative Angelegenheit, bei der wir es in allen Bereichen mit langen Zeiträumen zu tun haben. Das beginnt mit einer langen Planungsphase, der dann wiederum eine lange Bauphase folgt. Durch die lange Lebensdauer von Gebäuden gibt es auch lange Gewährleistungsfristen. Insofern bedeutet es schlichtweg Sicherheit wie gewohnt zu planen und Produkte einzusetzen, die man kennt. Es gibt ja inzwischen ausreichend Forschung und Lösungsansätze, die aber noch zu wenig in der Praxis angekommen sind. Um etwas Neues auszuprobieren, muss ich mich auch selbst öffnen. Der Wissenstransfer spielt also eine entscheidende Rolle – hier gibt es nach wie vor große Lücken. Auch in der Lehre gibt es noch Optimierungsbedarf. Wir stellen immer wieder fest, dass die Zusammenhänge von nachhaltigem, kreislauffähigem Bauen nicht verstanden werden. Dann klappt es auch mit der Umsetzung nicht.
Zudem werden Veränderungen auch durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen erschwert. Es gibt in Deutschland beim Bauen unglaublich hohe und viele Anforderungen.
Könnte man den Standard irgendwie absenken? Also selbstverständlich so, dass die Gebäude nicht gleich zusammenbrechen?
Eine Forderung ist das einfache Bauen, also dass wir zu einfacheren Lösungen zurückgehen. Wir sind es gewohnt, die Gebäude in einem hohen Maße mit Technik auszustatten, um einen möglichst hohen Komfort zu gewährleisten. Demgegenüber zeichnet sich das einfache Bauen dadurch aus, dass es sich an regional bewährtes Wissen und Bautechniken orientiert und dabei mit möglichst wenigen unterschiedlichen Materialien arbeitet und den Einsatz von Technik auf das Minimum reduziert. In diesem Bereich gibt es genug Forschung – beispielsweise die Forschungshäuser in Bad Aibling, die nachweisen, dass man sehr gute Ergebnisse erzielen kann, ohne diese ganze technische Ausstattung zu verwenden.
Man darf dabei auch nicht vergessen: Alles, was wir technisch ausstatten, muss gewartet und erneuert werden Die Lebensdauer von Technik ist die kürzeste in Gebäuden. Und wir brauchen sehr viel Raum dafür. Man denke an die Aufbauten auf den Dächern, die nur für die Klimatechnik benötigt werden. Oder an die ganzen Heizungskeller. Wir sind da schon auch gefangen.
Auch in unseren Vorstellungen, oder? Man denke an all das, was man beim Bauen unter „modern“ oder „repräsentativ“ versteht.
Bauen war noch nie unpolitisch. Gebäude stellen immer auch etwas dar, das heißt ich positioniere mich damit gesellschaftlich. In den letzten Jahren galten Stahl-Glas-Paläste als repräsentativ. Dann haben einige Leuchtturmprojekte gezeigt, dass es auch anders geht. Baustoffe, die früher als primitiv abgekanzelt wurden, wie zum Beispiel Lehm, erlebten eine Renaissance. Genau wie der Holzbau. Es ist inzwischen bei den meisten angekommen, dass man mit Holz sehr wohl auch hoch bauen kann. Diese ganzen überholten Ansichten, die schon lange herumschwirren, wandeln sich gerade. Es zeigt sich, dass man sich heute auch mit anderen Bauweisen positionieren und repräsentativ bauen kann.
Oder vielleicht auch gar nicht repräsentativ bauen muss, weil man mit diesem Thema souveräner umgeht.
Ja, wenn man sich die Gebäude der Pritzker-Preis-Gewinner der Jahre 2021, das waren Lacaton & Vassal, und 2022, das war Francis Kéré, anschaut, dann sind die alles andere als im herkömmlichen Sinn repräsentativ. Architektur und Design sind zwei Fachgebiete, die Denkmuster in Frage stellen können. Lacaton & Vassal sowie Kéré mit dem Pritzker-Preis auszuzeichnen, war ein ganz wichtiges Zeichen. Francis Kéré arbeitet mit vorgefundenen Materialien und einfachen Werkstoffen. Er orientiert sich an traditionellen Bauprinzipien und transferiert diese in die Gegenwart. Lacaton & Vassal gestalteten nicht nur mit einfachen Mitteln und mit wenig Aufwand zum Beispiel sozialen Wohnungsbau neu und machen diesen wohnlicher. Vielmehr haben sie dabei sogar den Anspruch, dass die dort Wohnenden so leben sollen wie reiche Menschen. Das hat schon eine Wirkung!
Manche fordern ja, dass man noch mehr „den Märkten“ überlassen muss, damit da endlich mehr passiert, damit man mehr Veränderung bekommt. Andere sagen aber, es braucht mehr politische Vorgaben, mehr politische Planung. In welche Richtung würden Sie tendieren?
Diese Argumente kenne ich rauf und runter. Am Ende des Tages können wir, glaube ich, auf die Politik nicht mehr warten. Die Zeit haben wir einfach nicht. Die Verantwortung wird ja immer gerne auf andere geschoben: Die Bauwirtschaft schiebt sie auf die Planenden, die Planenden auf die Investoren und am Ende landet alles bei der Politik, von der sich niemand wünscht, dass sie wirklich etwas ändert. Wir haben viele bleierne Jahre hinter uns, in denen sich wenig verändert hat. Die Menschen kennen es gar nicht, dass sich in Deutschland wirklich irgendwas bewegt und sie Teil davon sind. Die Frage ist daher, ob Deutschland überhaupt reformierbar ist. Wenn ich als Politiker neue Wege gehe, einen großen Wurf landen möchte und wirklich mal weitreichend plane, dann werde ich geköpft. Wenn ich die Politik beraten würde, würde ich sagen: „Hm.“ (lacht)
Weil zukunftsweisende Vorschläge nur für Verunsicherung sorgen?
Die Leute sind gleich auf Alarm, wenn seitens der Politik Veränderungsvorschläge kommen. Jetzt haben wir eine Regierung gewählt, die eher bewahrt als innovativ die Zukunft gestaltet. Dabei wäre es das Mindeste, die Rahmenbedingungen insoweit anzupassen, dass klimaschädliche Subventionen reduziert werden, anstatt sie weiter auszubauen. Es ist verrückt: Wir bezahlen nach wie vor Unsummen, nämlich jährlich über 60 Mrd. Euro, an klimaschädlichen Subventionen. Dabei sprechen wir immer nur darüber, was der Klimaschutz kostet. Die Klimafolgeschäden werden uns voraussichtlich das sechsfache kosten.
Zumal kleine Schritte, die man politisch gut verkaufen könnte, nichts bringen angesichts der Situation, in der wir klimatisch, ökonomisch und sozial schon sind. Sie haben auf einem Vortrag gesagt: „Ein bisschen besser reicht nicht mehr.“ Brauchen wir so etwas wie eine Bau-Revolution?
Man kann es noch zuspitzen und sagen: „Ein bisschen schwanger geht ja auch nicht.“ Entweder wollen wir eine Veränderung und das Thema Klimakrise anpacken, dann müssen wir uns alle verändern – alle! – oder wir lassen es. Dazwischen gibt es nicht mehr viel Spielraum. Wir sehen das doch überall. Wir erleben bereits diese ganzen Wetterkapriolen. Und dass sich Europa immer weiter aufheizt, ist jetzt auch kein Geheimnis. Wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass wir in allen Bereichen dekabonisieren müssen, aber wir packen es nicht an. Die Themen „Lust, Freude, Leidenschaft“ fehlen mir dabei komplett. Es geht ja darum, es besser zu machen. Die Lebensbedingungen verbessern sich durch mehr Klimaschutz. Und wirtschaftlich gesehen entstehen neue Geschäftsmodelle.
Wir führen so lange Scheindebatten, bis alles zerredet ist und es eigentlich nicht mehr um das Wesentliche geht. Das schafft zusätzliche Verunsicherung, die populistischen Strömungen die Türen öffnen. Anstelle dessen brauchen wir eine Idee wie wir in Zukunft leben wollen, die von Seiten der Politik und der Gesellschaft getragen wird.
Natürlich wollen jene, die die gängigen Geschäftsmodelle betreiben und damit sehr viel Geld verdienen, nicht davon abrücken, das ist klar. Aber wenn wir vom Markt sprechen, der alles regelt, dann würde es dazugehören, Subventionen in fossile Industrien abzuschaffen und faire Steuerregelungen einzuführen. Zum Beispiel recycelte Produkte nicht nochmal mit 19 % MWSt zu belasten.
Würde man vernünftig planen, müsste der Bau neuer Wohnungen und Gebäude stark reduziert oder gar ganz ausgesetzt werden. Stichworte Ressourcen, CO2, Zersiedelung, Versiegelung. Ist das realistisch angesichts der aktuellen Interessenlagen und Gewohnheiten in der Bauwirtschaft?
Nein, aber das ist auch nicht die Frage. Die eigentliche Frage ist, wie wir künftig leben wollen? In Deutschland wächst kontinuierlich der Wohnraumbedarf und unser Flächenbedarf. Obwohl es kein signifikantes Bevölkerungswachstum gibt. Wir nehmen mehr Fläche für uns selbst in Anspruch und damit auch mehr Siedlungsfläche, mehr Verkehrsfläche. Wir bauen und bauen und zersiedeln unser Land. Wir brauchen Infrastrukturen und Verkehrsflächen für die neu entstandenen Wohngebiete, die enorme Kosten verursachen. Wir versiegeln nach wie vor Flächen – bis zu 30 Fußballfelder pro Tag. Das hat weitreichende Folgen: den Verlust an Biodiversität, die Entstehung von Hitzeinseln und die Überlastung der Kanalisation bei Starkregen.
An den alten Einfamilienhaussiedlungen sehen wir aktuell die Probleme, die uns bei den neuen Siedlungen in Zukunft bevorstehen. Es gibt in diesen Gebieten keine Diversität, keine Durchmischung. Jetzt werden die dort Wohnenden gemeinsam mit ihren Häusern alt und vereinsamen. Viele von ihnen wollen aber nicht ausziehen. Und wenn sie sterben, ist die große Frage was mit den Häusern passiert, weil diese gar nicht mehr den Standards entsprechen. Der Aufwand für die Anpassung an heutige Anforderungen plus die energetische Sanierung steht aber oft nicht im Verhältnis zu dem, was man als Ergebnis erwarten kann.
Auch die Pflege ist in diesen Gebieten ein großes Thema. Die Pflegenden sollten ja nicht zu den Wohnhäusern, sondern die zu Pflegenden in die betreuten Häuser. Zudem möchten gerade die alten Menschen selten jemanden im Haus haben. Es sei denn, sie sind in so einem schlechten Zustand, dass sie rund um die Uhr eine Pflegekraft brauchen – die dann bitte schön ins Haus ziehen und ihre eigene Familie vernachlässigen soll.
All das ist nicht durchdacht. Das Ganze fußt auf dem alten Wohlstandsversprechen: das Haus im Grünen mit Garten und Doppelgarage – ein amerikanischer Traum, der nach wie vor in Medien, Werbung und in Filmen weitergeträumt wird. So glauben viele Leute nach wie vor, dass es das Ziel sein muss, ein Einfamilienhaus im Grünen zu besitzen.
Angesichts der zunehmenden Vereinsamung wird ein gemeinschaftlicheres Wohnen gefordert. Können Sie skizzieren, wie so etwas umgesetzt werden könnte?
Zunächst müssten die Viertel mit jungen und alten Leuten durchmischt werden und ein gemeinschaftlicher, partizipativer Ansatz bei der Planung verfolgt werden, um eine lebenswerte Infrastruktur zu schaffen. Wir brauchen Orte, wo man sich begegnen kann. Orte, an denen man sich gerne aufhalten möchte. Zu einer Quartiersentwicklung gehört auch, dass je nach Lebensphase unterschiedliche Wohnräume zur Verfügung stehen. Singles, Paare, Familien haben verschiedene Anforderungen, die sich mit den Jahren ändern können. Aus Singles werden Paare. Familien brauchen nicht mehr so viel Platz, sobald die Kinder aus dem Haus sind.
Im Moment haben wir es mit reinen Wohnsiedlungen zu tun. Man braucht zwangsläufig ein Auto. Und wir haben dadurch noch etwas anderes geschaffen: die sogenannten Zwischenstädte. So werden diese großen Einkaufszentren auf der grünen Wiese genannt. Man trifft sich nur auf dem Parkplatz – anschließend fährt jeder wieder in sein eigenes Zuhause. Gleichzeitig verwaisen unsere Ortskerne. Sie sind keine Orte der Begegnung mehr und der Zusammenhalt geht verloren.
Ich finde es schade, dass wir so wenig bereit sind unsere Zukunft zu gestalten. Die Zukunft kommt sowieso, ob ich sie gestalte oder nicht, aber jetzt haben wir die Möglichkeit, sie mitzugestalten.
Wäre es auch an der Zeit, einen flexibleren Umgang mit Eigentum zu finden? Ältere und Boomer reisen ohne Ende, ihre Wohnungen stehen leer. Junge Leute sind örtlich nicht gebunden und würden sich freuen, dort eine Zeit lang einzuziehen. Braucht es neue Wohnkonzepte, die den Leerstand flexibel nutzen?
Auf jeden Fall. Das hat sehr viel mit unseren Köpfen zu tun. Gerade in Deutschland ist die Einstellung „My Home is my Castle“ fest verankert. Das hier gehört mir, da darf niemand rein! Dazu gehört auch dieses krampfhafte Festhalten am Besitz, der ja auch viel Arbeit macht. Alles muss gepflegt werden: der Garten, die Fassade, das Dach, die Heizung, die Innenausstattung …. Insbesondere für ältere Menschen ist das eine enorme Belastung.
Wir reden ja oft über Freiheit und die Frage ist: Hat es mit Freiheit zu tun, wenn ich an ein Haus gebunden bin? Oder ist es nicht sinnvoller zu sagen „Ich wohne da nur“? Und das ist der entscheidende Punkt: Wir wohnen alle. Bei der Arbeit ist es etwas anderes, denn nicht alle Menschen arbeiten, gerade die Älteren sind raus aus der Arbeitswelt. Aber Wohnen ist ein Grundrecht. Wenn die Frage geklärt wäre, wie wir den Wohnraum umverteilen, wie wir ihn anders nutzen auch teilen, dann wären wir auf einem guten Weg und müssten nicht so viel neu bauen. Aber dazu braucht es eben die Bereitschaft in der Breite – und Anreize, die wir im Moment nicht haben.
Bauen wie auch Umbauen benötigen Energie. Und Energiesicherheit. Manche behaupten, dass die Fossilen mehr Sicherheit bieten würden und wir deshalb eben leider in den sauren Apfel beißen und weiterhin klimaschädliche Gase produzieren müssten. Ist es so, dass die Erneuerbaren unsicherer sind?
Nein. Aber ich denke, das Argument wird sich noch länger halten. Wir müssen nur nach Frankreich schauen: Wie gut funktionieren denn die Atomkraftwerke, wenn es im Sommer heiß ist und die Flüsse trocken liegen? Dann müssen diese oft gedrosselt oder gar ganz runtergefahren werden, weil das Kühlwasser zu warm ist. Die Frage ist gar nicht mehr, ob wir das mit Erneuerbaren schaffen oder nicht. Weltweit wird massiv in erneuerbare Energiequellen und Speichertechnologien investiert. Letztendlich geht es darum, wie wir Energie speichern und vorrätig haben, wenn wir sie punktuell brauchen. In der Spitze sind auch in Deutschland mehrheitlich erneuerbare Energien im Einsatz.
Könnten durch den Zwang zur Umstellung auf die Erneuerbaren auch Chancen entstehen? Muss Europa nicht sogar auf die Erneuerbaren setzen, wenn es wettbewerbsfähig bleiben will?
Das ist eigentlich schon der Fall. Ein großes Thema in der Bauwirtschaft sind Ausschreibungen. Wenn die Kriterien dieser Ausschreibungen so gesetzt sind, dass Hersteller eine Ökobilanz beziehungsweise einen Nachhaltigkeitsbericht nachweisen müssen, dann ändert das die ganze Herangehensweise in der Beschaffung. Und inzwischen ist CO2 ja eine Form von Währung geworden, das bedeutet die Reduzierung von CO2 Emissionen spart einfach Geld. Unternehmen bilanzieren und bewerten ihre Tätigkeiten, um dem Markt gerecht zu werden und der fordert mehr und mehr nachhaltiges, soziales und CO2 reduziertes Wirtschaften.
Diese Entwicklung kann man nicht mehr umkehren. Der CO2-Preis wird steigen, das geliebte Gas wird teurer. Die Unabhängigkeit, die wir durch Erneuerbare bekommen, wird viel zu wenig betont. Wir machen uns unabhängiger von anderen Ländern und auch von Despoten. Das kann man schon als Chance sehen, als Wettbewerbsvorteil für Deutschland.
Aber stattdessen versucht auch Deutschland den europäischen Green Deal zu verwässern. Damit vergeben wir die Chance zukünftig weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Das ist meiner Meinung nach eine Katastrophe und alles andere als zukunftsfähig.
In der Regel geht man davon aus, dass man das fossile Niveau durch die Erneuerbaren 1:1 ersetzt. Tatsächlich müssen wir aber den Energieverbrauch insgesamt massiv reduzieren. Vor diesem Hintergrund: Benötigen Umbauten weniger Energie als Neubauten?
Ja, wenn wir das Bauen im Bestand wirklich umsetzen. Der mit Abstand größte Anteil an grauen Energien, also an gespeichertem CO2, steckt im Rohbau. Das heißt, wenn der Rohbau stehen bleibt, das sind ja mitunter Stahlbetonkonstruktionen, dann haben wir schon den wesentlichen Anteil an gebundenem CO2 gerettet.
Wir reißen heute leichtfertig Gebäude ab, weil wir sie nicht mehr schön oder zeitgemäß finden. Aber auch diese Gebäude sind identitätsstiftend und Teil unserer Baukultur. Hätten unsere Vorfahren so agiert, gäbe es heute kein baukulturelles Erbe.
Immer häufiger sind wir mit Extremwetterereignissen wie Starkregen oder großer Hitze konfrontiert. Wie können wir Städte und Gebäude auf solche Ereignisse vorbereiten?
Die Städte müssen in die Lage versetzt werden, Wasser aufnehmen und wieder abgeben zu können. Man spricht in der Stadtplanung von Schwammstädten. Im Moment sieht das zumeist ganz anders aus: Es gibt überall versiegelte Flächen, das bedeutet, das ganze Regenwasser landet in der Kanalisation. Kommt es zu Starkregenereignissen, ist die Kanalisation dann schnell überfordert und es kommt zu Überschwemmungen. Um dem entgegenzuwirken, müssen wir die Böden entsiegeln. Städte wie Stuttgart fördern deshalb Entsieglungsmaßnahmen. Das wäre der erste Schritt. Eng damit verbunden ist die Frage der Mobilität, denn einen großen Teil der versiegelten Flächen machen die Straßen aus. Bei den Metropolen findet gerade so eine Art Wettkampf statt: Welche Stadt wird am schnellsten grün? Paris ist ein gutes Beispiel: Sie begrünen ihre Stadt nicht etwa aus einer verrückten Laune heraus, sondern es gibt einen ganz rationalen Grund. Bevor mit den Begrünungsmaßnahmen begonnen wurde, war das die Metropole mit dem wenigsten Grün. Es gab zahlreiche Hitzeinseln in der Stadt, was sehr belastend für die dort Wohnenden war. Investoren haben sich überlegt, ob sie weiterhin in Paris investieren sollen, denn schließlich müssen die Mitarbeitenden ja irgendwo wohnen. Es gab also auch wirtschaftlichen Druck zur Veränderung. In den weltweiten Vergleichen sucht man deutsche Städte allerdings vergebens. Man hat noch nicht erkannt, welche Vorteile man durch solche Veränderungen hat.
Die Entsieglung- und Begrünungsmaßnahmen werden in Paris seit 2014 umgesetzt. Paris ist also keine Stadt wie Kopenhagen, die schon 1973 mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung begonnen hat, sondern hier sehen wir die Veränderungen sehr komprimiert in Echtzeit. Wir können nun anhand der Zahlen präzise nachvollziehen, dass sich die Anzahl der Stickoxide in der Stadt um mehr als die Hälfte verringert hat. Wir können sehen, dass sich die Stadt erheblich abgekühlt hat – in kürzester Zeit, also in elf Jahren. Der Kühlungseffekt durch Pflanzen ist enorm. Was mich wirklich überrascht hat: In Santiago de Compostela gibt es diesen großen Vorplatz an der Kathedrale, auf dem sich die Pilger nach ihren langen Wanderungen treffen. Während Corona sind Pflanzen zwischen den Pflastersteinen gewachsen, weil der Platz einfach von viel weniger Menschen besucht wurde. Man hat Messungen vorgenommen und festgestellt, dass diese kleinen Pflänzchen, die wir auf Plätzen und Terrassen eigentlich immer rausschneiden, einen enormen Kühlungseffekt haben. Sie haben die Temperatur des Bodens bis zu 28 °C verringert. Es gibt Potenziale, von denen wir noch gar nichts wissen. So können wir auch mit kleinen Schritten in Städten viel bewirken.
Dann würde auch für eine Stadt wie Stuttgart noch Hoffnung bestehen? Denn oft heißt es, Stuttgart sei so stark aufs Auto ausgerichtet, da könne man eh nichts verändern.
Auf jeden Fall. Wir haben unser Büro mitten im „Superblock West“, das ist ein Verkehrsversuch, den die Stadt Stuttgart durchführt. Ziel ist es nicht etwa, das Auto zu verbieten, sondern den PKW-Durchgangsverkehr cleverer zu organisieren. Dadurch gewinnt man Freiflächen, die durch Begrünung, Außengastronomie und Sitzgelegenheiten genutzt werden können. Und dies gewinnt man alles nur, weil der Verkehr anders geleitet wird! Auch hier gibt es übrigens internationale Beispiele, so wird in Barcelona das Konzept der Superblocks bereits seit 2017 umgesetzt. Die Frage beim Bauen ist nicht mehr, auf welche Weise wir bestimmte Dinge umsetzen können, sondern die Frage ist, wann wir damit starten. Wir wissen, dass wir auf die Erneuerbaren und auf nachwachsende Rohstoffe setzen müssen; wir wissen, wie wir Materialien aus Bestandsgebäuden wiedergewinnen können. Wir wissen das alles. Wir können morgen starten. Dadurch würden ganz neue und zahlreiche Geschäftsfelder entstehen. Hier geht es überhaupt nicht um Verbote oder darum, sich einzuschränken, sondern eigentlich darum, etwas anders zu machen, etwas Neues auszuprobieren. Und ich finde es sehr schade, dass wir so wenig Mut dazu haben. Und so wenig Lust darauf haben. Da ist Deutschland schon sehr bräsig und verhaltend.
Bei unserer Arbeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass Wissen allein nicht zum Handeln führt. Es sind die Gefühlswelt, die Werte und Überzeugungen, die wir in uns tragen, die entscheidend sind für das Handeln – es geht also auch darum Haltung zu zeigen.
Bräuchten wir dann eine ganz neue Form der Politik? Politiker*innen, die wirklich ein Interesse an Veränderung haben, die nicht nur den Niedergang verwalten?
Ich glaube schon. Wir wählen halt jene Politiker*innen, die sagen: „Es wird sich nichts ändern. Es bleibt alles, wie es ist.“ Diese bleierne Zeit, von der wir dachten, sie langsam hinter uns lassen zu können, will nicht nur nicht enden, es wird sogar noch schlimmer. Wir versuchen, eine Zeit zu kopieren, die es schon lange nicht mehr gibt. Wir versuchen, Industrien zu retten, die eigentlich nicht mehr zu retten sind.
… und deren Fortbestand uns und unseren Kindern überdies schadet …
Genau. Und das tun wir mit sehr viel Aufwand und geben dafür sehr, sehr viel Geld aus. Ich hoffe nur, dass irgendwann der Groschen fällt, weil wir hier in Deutschland sehr viel Gutes aufbauen könnten. Wir haben das Geld, wir haben die Industrien, wir haben das Know-how, wir haben die Menschen. Es bräuchte jetzt einen Schub, um den Menschen zu vermitteln: „Okay, wir starten in eine bessere Zukunft.“ Das sehen wir im Moment leider nicht.
Frau Kammer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.